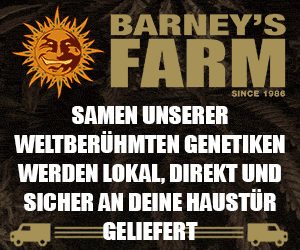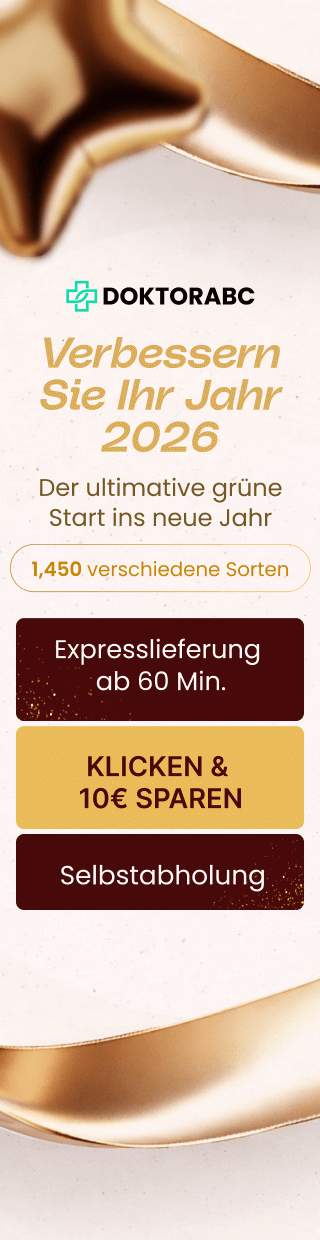Seit vielen Jahren ist bekannt, dass Cannabis eine Behandlungsmöglichkeit bei Schlafapnoe sein kann. Die Wirksamkeit wurde in mehreren Studien nachgewiesen. Dennoch war auch in Deutschland die Wirksamkeit von Cannabis bei Schlafapnoe immer wieder ein Streitthema. Größere mediale Aufmerksamkeit erreichte die Erkrankung im Jahr 2021, als ein Patient vor Gericht klagte, da die Krankenkasse sich weigerte, die Kosten für medizinisches Cannabis zu übernehmen, obwohl andere Therapiemöglichkeiten nicht gegen seine Beschwerden halfen.
Mediziner gehen davon aus, dass bis zu 30 % der Bevölkerung an Schlafapnoe leiden, vielfach, ohne dass die Betroffenen selbst davon wissen. Die Erkrankung ist gekennzeichnet durch Aussetzer der Atmung während des Schlafs. Dies kann unbehandelt zu einer ganzen Reihe weiterer gesundheitlicher Probleme führen. Durch einen gestörten Schlafrhythmus kann es am Folgetag zu Erschöpfung und Sekundenschlaf kommen, wodurch der Alltag erheblich eingeschränkt ist. Auch die medikamentösen Behandlungsmöglichkeiten sind derzeit sehr begrenzt. In jüngster Vergangenheit wurde in den USA die größte bisherige Studie zur Wirksamkeit von Cannabis bei Schlafapnoe veröffentlicht, die seine Wirksamkeit weiter unterstreicht.
Studie an knapp 3000 Patienten
Von 2018 bis 2023 nahmen im Rahmen des Minnesota Medical Cannabis Program 2982 Patienten mit einer diagnostizierten Schlafapnoe an einer Studie teil, welche die Effektivität von Cannabis zur Symptomlinderung untersuchte. Seit 2018 ist Schlafapnoe in Minnesota eine Indikation für die Verschreibung von medizinischem Cannabis. Voraussetzung für die Teilnahme an der Studie war die Diagnose einer mindestens mittelschweren obstruktiven Schlafapnoe. Die Schwere wurde mithilfe von Daten aus dem Schlaflabor und dem daraus erstellten Apnoe-Hypopnoe-Index (AHI) beziffert. Dieser Wert gibt die Anzahl der vollständigen und teilweisen Aussetzer der Atmung pro Stunde Schlaf an. Bei einem AHI-Wert von 15 bis 30 spricht man von einer mittelschweren Schlafapnoe, alles darüber gilt als schwer. Der durchschnittliche AHI-Wert der rekrutierten Teilnehmer lag bei 23,9.
Neben der Schlafapnoe klagte der Großteil der Patienten auch über weitere Begleiterscheinungen. Über 90 % gaben an, an mittelschweren bis schweren Schlafstörungen zu leiden. Knapp 90 % berichteten von starker Müdigkeit und Erschöpfung im Alltag. Da Schlafapnoe psychische Folgeerscheinungen mit sich bringt, waren auch Angstzustände und Depressionen weit verbreitet. Etwa 40 % der Patienten waren jeweils davon betroffen. Die Patienten bekamen Cannabis von ihrem Arzt verschrieben und füllten bei jedem Kauf einen Fragebogen aus, der die Symptome erfasste. Mit 64,2 % waren Blüten und vorgerollte Joints die häufigste Darreichungsform von medizinischem Cannabis, gefolgt von oralen Darreichungsformen, die meist in der Form von Kapseln konsumiert wurden. Knapp über 60 % der benutzten Cannabisprodukte waren stark THC-dominant, während der Rest ein eher ausgewogenes Verhältnis aus THC und CBD hatte.
Deutliche Symptomlinderung nach kurzer Zeit
Bereits nach wenigen Wochen kam es zu einer signifikanten Verbesserung der Symptomatik. Die Symptome wurden mittels Fragebogen auf einer Skala von 1 bis 10 bewertet. 40 % der Patienten berichteten von einer deutlichen Verbesserung ihrer Schlafprobleme um mindestens 30 %. Über 50 % gaben an, sich im Alltag deutlich weniger erschöpft zu fühlen. Über ein Drittel der Patienten, die unter Angst und Depressionen als Begleiterscheinung litten, berichtete ebenfalls von einer deutlichen Verbesserung.
Interessanterweise wurde im weiteren Verlauf der Studie der AHI-Wert im Schlaflabor nicht neu bestimmt. Jedoch wird in der Publikation auf frühere Studien verwiesen, bei denen ein signifikant niedriger AHI-Wert nachgewiesen werden konnte. So konnte in einer Studie mit 73 Patienten, die an einer mittelschweren Schlafapnoe litten, durch die orale Gabe von Dronabinol der AHI-Wert innerhalb von 6 Wochen um durchschnittlich 10,7 Punkte reduziert werden.
Gute Verträglichkeit
Die Therapie mit Cannabis wurde von der Mehrheit der Teilnehmer gut vertragen. Lediglich 16,5 % berichteten von Nebenwirkungen, wobei diese in der Regel leichter Natur waren. Starke Nebenwirkungen wie Panik waren die Ausnahme. Das häufigste geschilderte Problem war Mundtrockenheit. Mehr als die Hälfte der Nebenwirkungen trat nur einmalig zu Beginn der Behandlung auf und verschwand danach.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Studie eine signifikante Symptomlinderung bei Schlafapnoe nachweisen konnte. Dies ist insbesondere für Patienten interessant, bei denen Hilfsmittel wie eine CPAP-Maske keine Linderung bringen oder nicht toleriert werden.