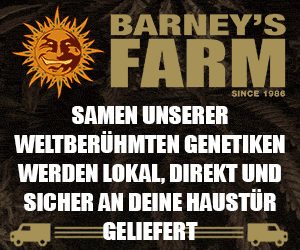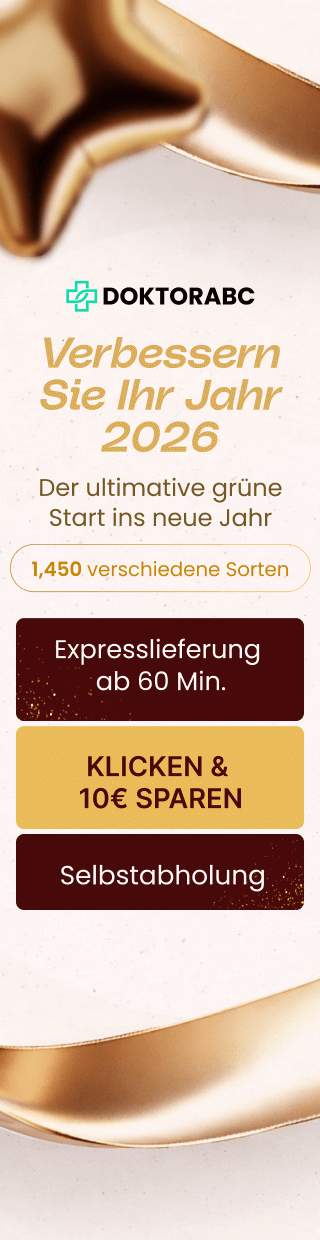Du willst diesen Beitrag hören statt lesen?
Klicke dazu auf den unteren Button, um den Inhalt von Soundcloud zu laden.
Die sogenannte Einstiegsdrogen-Theorie geht davon aus, dass der Konsum von Cannabis zwangsläufig zum Konsum weiterer Substanzen führt und häufig in problematischem Gebrauch endet. Der Begriff stammt ursprünglich aus den USA, aus der Zeit des „War on Drugs“. Mittlerweile haben sich jedoch mehrere internationale Gremien von dieser Vorstellung distanziert. Auch das deutsche Bundesverfassungsgericht entschied bereits 1994, dass Cannabis nicht zwangsläufig zum Konsum weiterer Drogen führt.
Dennoch wird die These bis heute als Hauptargument gegen eine Legalisierung genutzt – so auch in Japan, wo das Thema weiterhin tabuisiert und geächtet ist. 2024 sprach Japan für Deutschland sogar eine Reisewarnung aus, wegen einer angeblich eskalierenden Drogensituation. Doch eine neue Studie aus Japan zeigt nun, dass die Einstiegsdrogen-Hypothese längst überholt ist.
Anonyme Online-Umfrage mit fast 4.000 Teilnehmenden
Aufgrund der starken Stigmatisierung von Drogenkonsum wurde die Studie anonym im Internet durchgeführt. Über soziale Medien nahmen 3.900 Personen teil, überwiegend Männer im Alter zwischen 20 und 24 Jahren. Abgefragt wurden die Reihenfolge des Substanzkonsums, das seelische Befinden sowie mögliche Vorstrafen. Die Ergebnisse wurden in einem Sankey-Diagramm dargestellt, um die Chronologie des Konsums verschiedener Substanzen visuell zu verdeutlichen.
Alkohol und Tabak als wahre Einstiegsdrogen
Die Ergebnisse überraschen wenig: Cannabis wurde selten als erste psychoaktive Substanz konsumiert. Fast alle Befragten starteten mit Alkohol und Tabak. Typischerweise erschien Cannabis in der Konsumchronologie erst an dritter Stelle. Auffällig: Koffein, obwohl gesellschaftlich weitverbreitet, wurde in der Studie nicht erfasst. Die Daten widerlegen klar die Behauptung, Cannabis sei ein Türöffner für härtere Substanzen. Mehr als die Hälfte der Befragten, die Cannabis konsumiert hatten, probierte danach keine weiteren Drogen. Besonders interessant: Entgegen bisheriger Annahmen in Japan zeigte die Studie, dass Cannabis nicht automatisch den Einstieg in den Konsum von Methamphetamin bedeutet. Nur ein sehr kleiner Teil der Konsumenten griff später zu dieser Substanz.
Methamphetamin bleibt trotz Verbot ein gesellschaftliches Problem
Methamphetamin ist in Japan trotz restriktiver Drogenpolitik weitverbreitet – vor allem, um dem hohen Leistungsdruck standzuhalten. Bisher ging man davon aus, dass Cannabis zwangsläufig zu Methamphetaminkonsum führt. Die aktuelle Studie zeichnet jedoch ein völlig anderes Bild und stellt damit ein jahrzehntelang gepflegtes Dogma infrage.
Drastische Verschärfung der japanischen Drogenpolitik
Trotz dieser neuen Erkenntnisse hält Japan an seiner restriktiven Politik fest. Ende 2024 wurde die Gesetzeslage deutlich verschärft: Der bloße Konsum von Cannabis kann nun mit bis zu sieben Jahren Haft bestraft werden. Davor war lediglich der Besitz strafbar. Ein positiver Drogentest reicht aus, um verurteilt zu werden. Als Begründung für die Verschärfung wurde ein Anstieg des Konsums genannt. Gleichzeitig wird eingeräumt, dass diese Regelung die Polizei vor enorme Ressourcenprobleme stellen könnte.
Erste Lockerungen im medizinischen Bereich
Es gibt jedoch auch vorsichtige Fortschritte: Das Verbot von THC-haltigen Arzneimitteln wurde im Vorjahr aufgehoben. Zudem plant das japanische Gesundheitsministerium, bis Ende 2025 ein überarbeitetes Lizenzsystem für medizinische Anwendungen einzuführen. Damit könnte sich die Haltung gegenüber Cannabis mittelfristig verändern – auch wenn Japan weiterhin zu den Ländern mit der strengsten Drogenpolitik zählt.
Japan beginnt, alte Dogmen zu hinterfragen
Die neue Studie zeigt deutlich, dass Cannabis nicht die Rolle einer Einstiegsdroge erfüllt. Stattdessen sind es Alkohol und Tabak, die als erste psychoaktive Substanzen konsumiert werden. Auch wenn Japan seine restriktive Linie beibehält, lässt sich ein schrittweises Umdenken erkennen. Selbst in konservativen asiatischen Ländern wächst die Bereitschaft, die bisherige Drogenpolitik kritisch zu hinterfragen und wissenschaftliche Erkenntnisse stärker zu berücksichtigen.