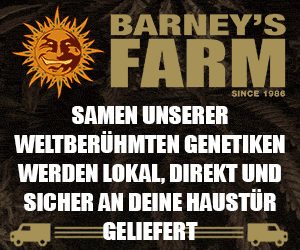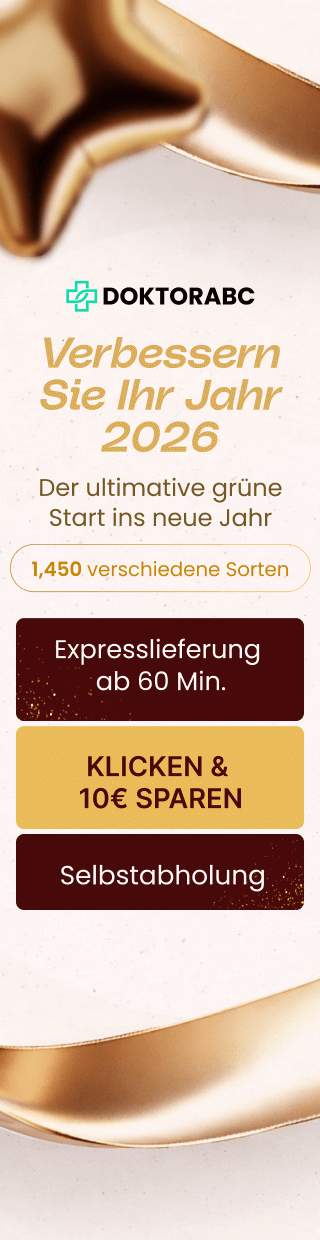Mit der Einführung des Cannabisgesetzes im April 2024 hat Deutschland ein Modell gewählt, das europaweit für Aufsehen sorgt. Erwachsene dürfen bis zu 25 Gramm bei sich führen, drei Pflanzen zu Hause anbauen und sich über Anbauvereinigungen mit bis zu 50 Gramm im Monat versorgen. Der kommerzielle Verkauf bleibt dagegen strikt verboten. Diese Konstruktion wurde von der Bundesregierung bewusst gewählt, um einerseits eine Entkriminalisierung zu erreichen, andererseits aber nicht in direkte Konkurrenz mit internationalen Handelsabkommen zu geraten.
Die ersten Monate zeigten, dass die prognostizierte Eskalation ausgeblieben ist. Statt steigender Kriminalität meldeten mehrere Bundesländer sogar einen Rückgang bei Drogendelikten. Gleichzeitig klagen Polizei und Justiz über Unklarheiten in der Umsetzung, da Grenzfälle – etwa beim Transport zwischen Wohnung und Club – weiterhin rechtlich schwierig bleiben. Damit wird deutlich, dass das Gesetz zwar vieles neu regelt, aber noch nicht alle Probleme löst.
Politische Stabilität oder notwendige Reform?
Nach dem Regierungswechsel im Frühjahr 2025 herrscht keine endgültige Klarheit über die Zukunft des Cannabisgesetzes. Im Koalitionsvertrag einigten sich CDU/CSU und SPD darauf, zunächst eine ergebnisoffene Evaluation im Herbst 2025 einzuleiten. Diese soll untersuchen, welche Auswirkungen das Gesetz bislang auf Konsumverhalten, Schwarzmarkt, Jugendschutz und Strafverfolgung hat. Während die SPD bisher am CanG festhält und auf positive Resultate setzt, signalisiert die Union, dass sie auf Grundlage der Ergebnisse eine Verschärfung anstrebt. Für Konsumenten und Anbauvereinigungen bedeutet dies vorerst Unsicherheit: Das Gesetz bleibt in Kraft, ist aber nicht langfristig abgesichert. Kritiker sprechen daher weiterhin von einer „halben Legalisierung“, da der kommerzielle Markt fehlt und der Schwarzhandel nach wie vor aktiv ist.
Besonders in den Clubs zeigt sich, wie bürokratisch der Weg zur legalen Versorgung ist. Hohe Auflagen, Mitgliedsobergrenzen und strikte Dokumentationspflichten machen den Betrieb aufwendig. Viele Initiativen scheitern bereits bei der Gründung. Die bestehenden Vereine sind für ihre Mitglieder ein Fortschritt, können den Bedarf der gesamten Konsumentenschaft aber nicht decken. Damit bleibt ein Spannungsfeld bestehen: Die Politik will kontrollierte Abgabe, schafft aber bislang keinen flächendeckenden Zugang.
Gesellschaftliche und medizinische Dimension
Neben den praktischen Fragen wird auch die gesellschaftliche Wirkung diskutiert. Befürworter betonen, dass die Normalisierung des Konsums Stigmata abbaut und Erwachsene eigenverantwortlich handeln können. Gegner warnen vor einem unklaren Signal an Jugendliche und fürchten gesundheitliche Schäden. Ärzte und Fachverbände zeigen sich gespalten: Während einige die Chance sehen, den Umgang mit Hanf entkrampfter zu gestalten, befürchten andere, dass Patienten durch die parallele Legalisierung verunsichert werden könnten.
Auch international wird das deutsche Modell aufmerksam beobachtet. Andere europäische Länder betrachten es als Testfeld für eine Regulierung, die nicht sofort auf einen kommerziellen Markt setzt. Ob sich Deutschland damit als Vorreiter oder als Sonderfall etabliert, hängt davon ab, wie sich Schwarzmarkt, Prävention und gesellschaftliche Akzeptanz entwickeln. Klar ist: Mit dem CanG hat die Bundesrepublik ein Experiment gestartet, das langfristig nachjustiert werden muss.