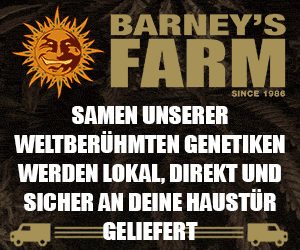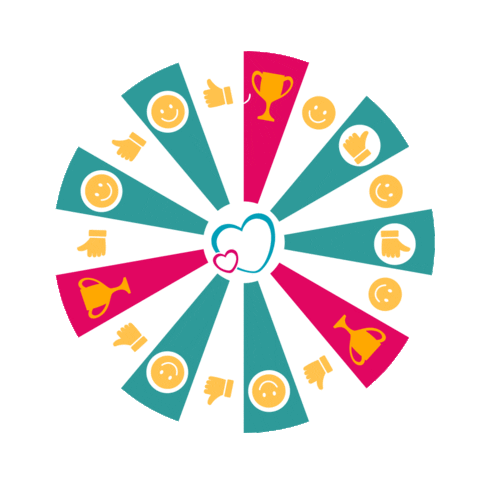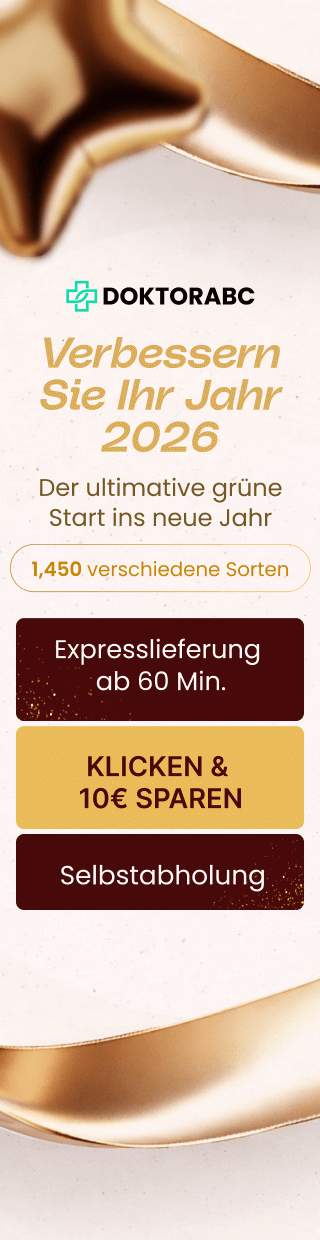Du willst diesen Beitrag hören statt lesen?
Klicke dazu auf den unteren Button, um den Inhalt von Soundcloud zu laden.
Ein Kommentar von Franziska Katterbach, Rechtsanwältin im Bereich Life Sciences / Healthcare bei Oppenhoff
Die Telemedizin boomt. Was während der Pandemie noch als pragmatische Notlösung galt, ist heute Teil einer Strategie, das Gesundheitswesen digitaler, zugänglicher und effizienter zu gestalten. Patientinnen und Patienten erwarten ärztliche Leistungen „on demand“, Investorinnen und Investoren sehen enormes Potenzial in Healthtech-Innovationen – und regulatorisch? Besteht nach wie vor Aufholbedarf. Gerade bei sensiblen Arzneimitteln wie medizinischem Cannabis zeigt sich: Nicht alles, was technisch möglich ist, ist auch rechtlich zulässig.
Mehr Digitalisierung – klar. Aber bitte mit Regeln
Politisch herrscht Einigkeit, die Telemedizin weiter auszubauen. Doch dieser Wille trifft auf ein komplexes Regelwerk, das Patientensicherheit und ärztliche Integrität über ökonomische Geschwindigkeit stellt. Aktuelle Urteile setzen so zum Beispiel bei der Verordnung von medizinischem Cannabis enge Leitplanken. Diese fallen deutlich strikter aus, als es viele Telemedizin-Anbieter bislang angenommen oder in ihrer Praxis umgesetzt haben.
So untersagte das Landgericht Hamburg (Urteil vom 11.03.2025, Az. 406 HKO 68/24) einem Telemedizin-Anbieter die Werbung mit Versprechen wie „Cannabis + Rezept einfach, schnell & günstig“. Gerade bei Cannabis, so das Gericht, sei aufgrund der bekannten Suchtgefahren, Nebenwirkungen und Missbrauchspotenziale ein persönlicher Arzt-Patienten-Kontakt zwingend notwendig. Auch pauschale Werbeaussagen für Wirkstoffe ohne konkrete Produktnennung verstoßen demnach gegen das Heilmittelwerbegesetz.
Das Oberlandesgericht Frankfurt (Urteil vom 06.03.2025, Az. 6 U 74/24) stieß sich insbesondere daran, dass Fernbehandlungen als einfache Alternative für Erstverschreibungen von Cannabis dargestellt wurden. Die Werbung mit Titeln wie „Expertin für Cannabinoid-Therapie“ wurde als irreführend gewertet, wenn die werbende Person selbst keine ärztlichen Leistungen erbringt. Zudem wurden vertragliche Modelle kritisiert, bei denen Plattformbetreiber prozentual an ärztlichen Honoraren beteiligt sind – ein klarer Verstoß gegen die ärztliche Berufsordnung.
Einen grundlegenden Maßstab für die Verordnungspraxis setzte das Bundessozialgericht (Urteil vom 29.08.2023, Az. B 1 KR 26/22 R): Ärztinnen und Ärzte dürfen Cannabis nur dann zulasten der gesetzlichen Krankenversicherung verordnen, wenn eine medizinische Indikation sorgfältig geprüft und dokumentiert wurde. Die Richter betonten, dass die ärztliche Einschätzung detailliert begründet und nachvollziehbar sein muss; pauschale Aussagen wie „austherapiert“ genügen nicht. Der Einsatz dürfe nicht leichtfertig erfolgen oder durch wirtschaftliche Interessen gelenkt sein. Die besondere Verantwortung bei der Verordnung von Betäubungsmitteln gilt auch und gerade in digitalen Settings.
Nicht zuletzt bestätigte der erste Strafsenat des Bundesgerichtshofs (Beschluss vom 20.03.2023, Az. 1 StR 266/22), dass die Verschreibung von Cannabis als Betäubungsmittel ohne medizinische Indikation und ohne gründliche Anamnese strafbar ist. Die Verschreibung von Betäubungsmitteln setze eine sorgfältige Prüfung der medizinischen Notwendigkeit voraus. Die Grenze zwischen erlaubter Fernbehandlung und strafbarer Handlung ist also schnell überschritten.
Darüber hinaus liefen bei verschiedenen Gerichten, darunter in Berlin, Hamburg und Leipzig, weitere Verfahren, die sich mit zentralen Fragen der Telemedizin und der Verordnungspraxis beschäftigen. Dabei geht es unter anderem um die Zulässigkeit von Geschäftsmodellen, bei denen Plattformbetreiber an ärztlichen Honoraren beteiligt sind, sowie um die Frage, ob automatisierte Prozesse wie standardisierte Fragebögen den Anforderungen an eine ärztliche Anamnese genügen. Auch die Rolle der Werbung für telemedizinische Leistungen steht weiterhin im Fokus, insbesondere wenn diese irreführenden Aussagen über die Einfachheit und Schnelligkeit der Behandlung enthält. Diese Verfahren zeigen, dass die rechtliche Klärung vieler Aspekte der Telemedizin noch im Fluss ist und sich die Rechtsprechung dynamisch weiterentwickelt.
Was sagt die Politik?
Der aktuelle Koalitionsvertrag betont die Förderung von Telemedizin und Digitalisierung im Gesundheitswesen, zugleich aber auch die Notwendigkeit klarer Qualitäts- und Sicherheitsstandards. Im jüngsten NTV-Interview warnte Gesundheitsministerin Warken vor dem „verstörenden“ Anstieg von Cannabis-Fernverschreibungen und stellte klar: „Für mich steckt ganz klar Missbrauch hinter den Zahlen.“
Die Gesundheitsministerkonferenz (GMK) fordert in ihrer jüngsten Resolution unter anderem eine verpflichtende persönliche Erstuntersuchung vor jeder Cannabisverordnung sowie bundeseinheitliche und rechtssichere Regelungen für telemedizinische Leistungen. Auch die Apothekerkammer Nordrhein schließt sich diesen Forderungen an und spricht sich zusätzlich für ein Versandhandelsverbot besonders missbrauchsanfälliger Arzneimittel, eine Registrierungspflicht für Plattformbetreiber sowie eine Klarstellung der Apothekenwahlfreiheit aus. Diese Maßnahmen sollen nicht nur Missbrauchspotenziale minimieren und die Patientensicherheit gewährleisten, sondern nach Vorstellung der Akteure auch gesetzlich verankert werden – etwa im Betäubungsmittelgesetz oder vergleichbaren regulatorischen Rahmenwerken.
Fazit: Mandat klar – Digitalisierung. Grenze klar – Recht/Rechtsprechung.
Die Zukunft der Medizin ist digital, keine Frage. Doch die Digitalisierung wird sich nur entfalten, wenn ärztliche Verantwortung, wirtschaftliches Interesse und rechtliche Rahmenbedingungen austariert werden.
Es ist zu erwarten, dass der gesamte Telemedizin-Plattformsektor im Bereich medizinisches Cannabis auf einen regulatorischen Prüfstand gestellt wird. Für etablierte Anbieter und solche, die es werden wollen, bedeutet das nicht nur Kontrolle, sondern auch die Chance, ihre Strukturen, Abläufe und Kommunikationswege kritisch zu hinterfragen – und so ein belastbares, vertrauenswürdiges Modell zu schaffen, das der rechtlichen Prüfung ebenso standhält wie dem Anspruch an eine verantwortungsvolle Patientenversorgung. Technisch ist vieles möglich. Juristisch ist vieles geregelt. Aber nur dort, wo beides zusammengeführt wird, entsteht echte Versorgungssicherheit.