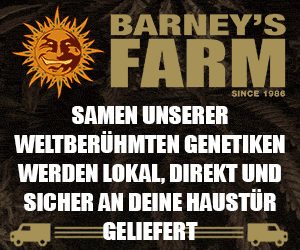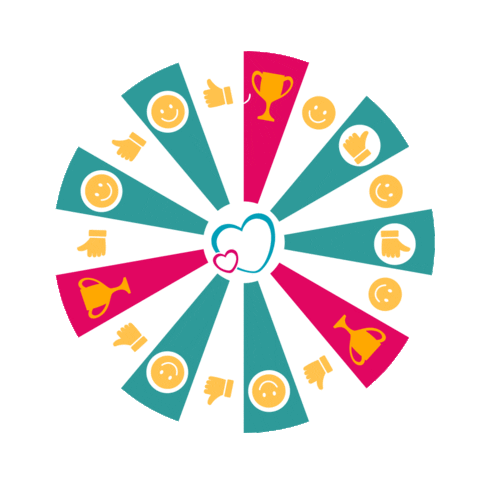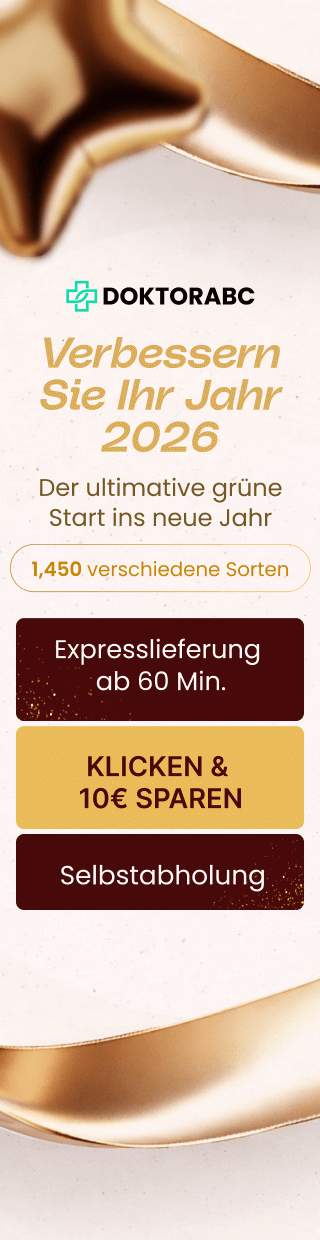Der objektive Nachweis einer Beeinträchtigung durch THC im Straßenverkehr ist bis heute ein kontroverses Thema. Unabhängig davon, dass der aktuelle Grenzwert sehr konservativ angesetzt ist und im Serum anstelle des Vollblutes gemessen wird, gibt es verschiedene Methoden, THC beim Verkehrsteilnehmer nachzuweisen.
Freiwillige Vortests liefern lediglich einen Anfangsverdacht, während vor Gericht ausschließlich eine Blutanalyse aus dem Labor verwertbar ist. In der Vergangenheit gab es immer wieder Bemühungen, am Straßenrand schnell und einfach eine Beeinträchtigung nachzuweisen, ähnlich wie man es von Alkohol kennt. Aufgrund der langen Abbauzeiten und anderer pharmakologischer Eigenschaften gestaltet sich dies bei THC jedoch deutlich schwieriger. Nun stehen Kapillarbluttests als mögliche neue Alternative im Raum.
Einer Anfrage der AfD an die Bundesregierung ist zu entnehmen, dass das Bundesministerium für Verkehr (BMV) derzeit die Möglichkeit prüft, mithilfe von Kapillarbluttests den aktuell geltenden Grenzwert im Rahmen von Verkehrskontrollen zu kontrollieren. Die Bundesanstalt für Straßen- und Verkehrswesen (BASt) wurde damit beauftragt, eine mögliche Umsetzbarkeit zu prüfen.
Kapillarbluttests – bekannt aus der Blutzuckermessung
Kapillarbluttests sind bislang vor allem von Blutzuckermessungen bekannt. Diabetiker nutzen diese Methode, um schnell und unkompliziert mit einem dafür konstruierten Stift ihren Blutzuckerwert zu bestimmen. Ein kleiner Stich in den Finger liefert den benötigten Tropfen Blut, um die Messung durchzuführen.
Bei Blutzucker funktioniert dieses Verfahren seit Langem zuverlässig, bei anderen Substanzen stößt die Methode jedoch an Grenzen. Erfahrungen aus anderen Ländern zeigen, dass die Technik Nachteile aufweist, die sie für Verkehrskontrollen bislang als nicht praxistauglich erscheinen lassen.
US-Studie: Kapillarblut liefert ungenaue Werte in den ersten Stunden
Eine 2025 veröffentlichte US-Studie kam zu dem Ergebnis, dass THC im Kapillarblut erst ab zwei Stunden nach dem Konsum sicher nachgewiesen werden kann. Im Zeitraum, in dem tatsächlich eine Beeinträchtigung vorliegt, lässt sich die Konzentration im Blut nicht zuverlässig bestimmen. Die Studienteilnehmer rauchten ihr selbst mitgebrachtes THC-haltiges Material. Anschließend wurde sowohl Kapillarblut als auch Venenblut aus dem Unterarm auf die Konzentration untersucht.
Die Messungen fanden 10, 30, 60, 90 und 140 Minuten nach dem Konsum statt. Auffällig war, dass in den ersten zwei Stunden die Werte im Kapillarblut deutlich niedriger lagen als im Venenblut – im Schnitt um 30 bis 40 Prozent. Erst nach mehr als zwei Stunden waren die Messwerte identisch. Geringere Unterschiede zeigten sich beim Abbauprodukt THC-COOH: Nur in der ersten Messung nach zehn Minuten gab es Abweichungen, danach lagen die Werte gleichauf. Für die Verkehrssicherheit bedeutet das: Genau in der Phase, in der eine starke Beeinträchtigung vorliegt, liefert das Verfahren keine zuverlässigen Ergebnisse.
THC im Kapillarblut länger nachweisbar als im Venenblut
Umgekehrt ist THC im Kapillarblut jedoch deutlich länger nachweisbar als im Venenblut. Auch in Österreich wird seit Jahren über die beste Nachweismethode im Straßenverkehr diskutiert. Das Bundesministerium für Innovation, Mobilität und Infrastruktur (BMIMI) wies in einer Publikation darauf hin, dass Proben aus Kapillarblut durch Gewebswasser eine verlängerte Nachweisbarkeit zeigen können.
Da THC sich nicht nur in Fettgewebe und Urin, sondern auch in anderen Körperflüssigkeiten über lange Zeiträume anreichert, führt dies zu einem doppelten Problem: Kapillarbluttests können eine Beeinträchtigung in den ersten zwei Stunden nach dem Konsum nicht zuverlässig ausschließen – gleichzeitig bleibt das bekannte Problem der langen Nachweisbarkeit bestehen, das über den eigentlichen Rausch hinausgeht.