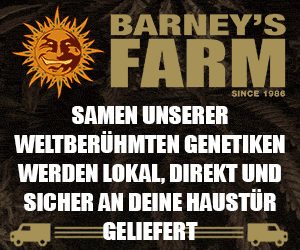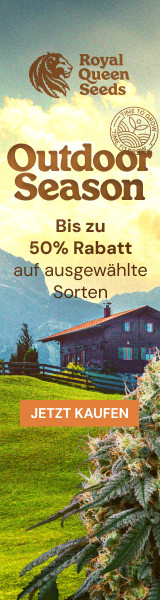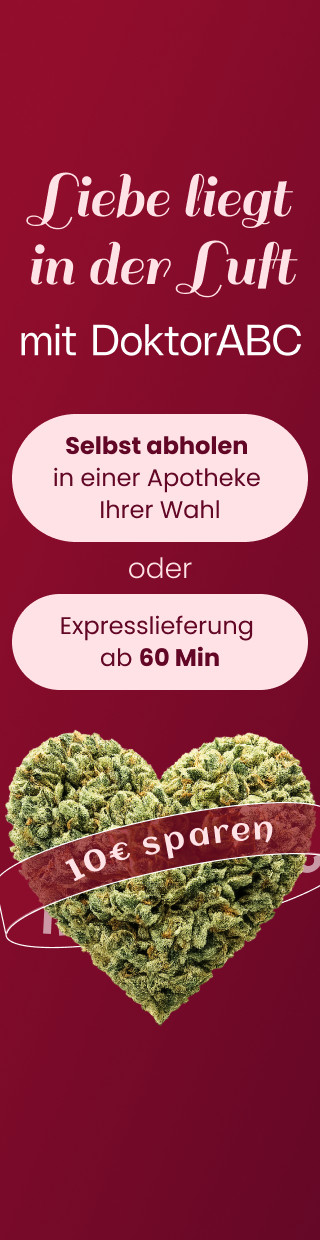Ajulemsäure ist ein vergleichsweise wenig bekanntes halbsynthetisches Cannabinoid, welches zuerst in den 1990er Jahren entdeckt wurde. In den vergangenen Jahrzehnten war Ajulemsäure immer wieder Gegenstand zahlreicher Studien, die bei einigen Indikationen sowohl eine entzündungshemmende als auch analgetische Wirkung nachweisen konnten. Ajulemsäure ist nicht psychoaktiv, was je nach Anwendungszweck auch von Vorteil sein kann.
Chemisch ist dieses Cannabinoid nahe mit Delta-8-THC verwandt. Während die meisten mit THC verwandten Cannabinoide potente CB1-Agonisten sind, dominiert die Wirkung von Ajulemsäure am CB2-Rezeptor. Ferner weist Ajulemsäure auch eine agonistische Wirkung am PPAR-Gamma-Rezeptor auf, einem Rezeptor des erweiterten Endocannabinoidsystems. Ajulemsäure ist auch unter weiteren Bezeichnungen wie Lenabasum oder JBT-101 bekannt. Ein gewisser Nachteil ist, dass im Gegensatz zu Delta-9-THC die antiemetische Wirkung fehlt. Gegen bestimmte Arten von Entzündungen und Autoimmunerkrankungen erwies sich Ajulemsäure jedoch als sehr vielversprechend. Nun wurden einige neue Studien veröffentlicht, die sich mit dem medizinischen Potenzial dieses Cannabinoids beschäftigen.
Vielversprechende Studienlage bei seltener Autoimmunerkrankung
Eine 2025 publizierte Verlängerungsstudie untersuchte die Wirksamkeit von Ajulemsäure bei Dermatomyositis. Dabei handelt es sich um eine seltene Autoimmunerkrankung, die vielfach therapieresistent ist. Die Erkrankung kann verschiedene Gewebe betreffen. Diese Studie konzentrierte sich auf Patienten, bei denen vorrangig die Haut betroffen war. Über einen Zeitraum von 3 Jahren wurden 20 Patienten mit therapieresistenter Dermatomyositis mit Ajulemsäure behandelt. Der Wirkstoff wurde dabei oral eingenommen. Alle 8 Wochen wurde eine Untersuchung zahlreicher Hautparameter durchgeführt. Die Verbesserungen waren erstaunlich. Bis zur Woche 68 hatten sich sowohl das Hautbild als auch das subjektive Befinden signifikant verbessert. Mehrere Indikatoren, mit denen Hautveränderungen bewertet werden, hatten sich deutlich gebessert.
Um die Verbesserungen des Hautbildes in Zahlen quantifizieren zu können, kam hauptsächlich die CDASI-Skala zum Einsatz. Dabei handelt es sich um ein standardisiertes Punktesystem, das Hautveränderungen an 15 Körperstellen beziffert. Unterschieden wird hierbei zwischen optischen Erscheinungen wie Rötungen und physischen Schädigungen. Optische Auffälligkeiten werden auf einer Skala von 0 bis 100 beziffert. Physische Schädigungen von 0 bis 32. Nach den ersten 68 Wochen zeigten Patienten eine durchschnittliche Verbesserung um 21,8 Punkte auf der CDASI-Skala.
Auch das Fortschreiten der Erkrankung konnte deutlich gemindert werden. 41,7 % der Patienten erlitten während des Beobachtungszeitraums keinen weiteren Krankheitsschub. Im Vergleich dazu zeigte die Kontrollgruppe ohne Ajulemsäure in 91,6 % der Fälle weitere Krankheitsschübe. 50 % der Patienten berichteten von einer anhaltenden Verbesserung des Juckreizes. Forscher gehen davon aus, dass Ajulemsäure eine vielversprechende und sichere Option zur Behandlung von Dermatomyositis sein könnte.
Verbessertes Verständnis des Wirkungsmechanismus
Eine weitere 2025 veröffentlichte Studie beschäftigte sich mit dem Verständnis des Wirkungsmechanismus von Ajulemsäure, insbesondere bei seiner Wirksamkeit gegen Dermatomyositis. Die Signalwege und genauen molekularbiologischen Vorgänge zu verstehen, ist die Grundvoraussetzung dafür, Wirkstoffe zielgerichtet einsetzen zu können. Ein US-Forscherteam untersuchte in-vitro in Leukozyten von Dermatomyositis-Patienten die genauen Signalwege, die über Ajulemsäure an den CB2- und PPAR-Gamma Rezeptoren vermittelt werden. Die Zellproben wurden in Responder und Nonresponder unterteilt, um die unterschiedlichen Wirkungsmechanismen analysieren zu können.
Ajulemsäure übt über diese Rezeptoren eine regulierende Wirkung auf den körpereigenen Botenstoff Interferon-Beta aus. Diese Wirkung erklärt nach heutigem Wissensstand ihre Wirksamkeit bei Autoimmunerkrankungen. Interferon-Beta hat eine modulierende Wirkung auf zahlreiche immunologische Prozesse und kommt medizinisch auch bei weiteren Autoimmunerkrankungen zum Einsatz. Es wurde festgestellt, dass die Wirksamkeit von Ajulemsäure im Kontext der Konzentration der CB2-Rezeptoren in den jeweiligen Zellen steht. Die Ergebnisse verbessern das Verständnis dafür, warum das Cannabinoid bei einigen Patienten eine stärkere Wirkung zeigt als bei anderen. Das Forscherteam geht davon aus, dass zukünftig ein Zelltest hilfreich sein könnte, um vorab die Wirksamkeit des Medikaments beim Patienten abschätzen zu können.
Optimiertes Syntheseverfahren
Wie bereits erwähnt handelt es sich bei Ajulemsäure um ein halbsynthetisches Cannabinoid, welches mit Delta-8-THC verwandt ist. Es gibt mehrere bekannte Syntheseverfahren mit unterschiedlicher Effizienz. Einem chinesischen Forscherteam gelang es 2024 in einem bestimmten Arbeitsschritt der Synthese, eine Oxidation zu optimieren, was zu einer deutlich höheren Ausbeute führte. Forscher gehen davon aus, dass sich mit diesem Verfahren auch weitere Derivate von Ajulemsäure ableiten lassen, die unter Umständen medizinischen Nutzen aufweisen.